
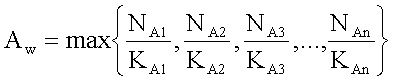
Wahrscheinlichkeit
relative Häufigkeit auf lange Sicht (Popper
1997, 186). Bei einem Würfel ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln,
1/6, d. h. bei einer großen Zahl von Würfen wird die Zahl 6 annähernd bei
einem Sechstel der Würfe vorkommen. Der Begriff wird auch verwendet, um den
Grad der Gewissheit zu bezeichnen, ob ein Ereignis eintritt oder nicht. Bei
Prognosen (auch bei Nutzwertanalysen)
können die möglichen Zustände/ Entwicklungen/ Eigenschaften mit einem Faktor
entsprechend der Wahrscheinlichkeit bewertet (gewichtet) werden.
Web 2.0
"Mitmach-Web", das durch die Aktivitäten der Nutzer gestaltet wird, nicht durch Anbieter von Inhalten. Das Web 2.0 entsteht durch die Eigenschaften der Interaktivität, dezentraler
Steuerung und Selbstorganisation, Netzwerkbildung, Bereitstellung von Leistungen und Inhalten durch die Nutzer selbst (Autopoiese), die mit modernen Programmen und Web-Angeboten möglich werden. Damit bekommt das Internet ein Potenzial und eine Dynamik, die von Anbietern selbst nicht erreicht werden könnte, und eine Offenheit für Entwicklungen, die nicht planbar ist und sein soll, dafür aber neue Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten bietet, die über zentral verwaltete Angebote weit hinausgeht. Beispiele: Foren, Wikipedia, Blogs, Youtube ... Mehr ...
Web Based Training (WBT)
Lernen über das Internet (auch "webucation" genannt). Es kann umfassen: Lernen
mit Computer-Lernprogrammen (CBT), die aber über das
Internet, Intra- oder Extranet bereitgestellt werden. Der Zugriff erfolgt zumeist
über Browser, also dem üblichen Programm
für den Zugang zum Internet. Oft wird neben dem Lernprogramm auch eine Lernumgebung
mit weiteren Funktionen zur Verfügung gestellt, z. B. Zugriff auf
den Stand der Bearbeitung der Lektionen, "Anschlagtafel" mit aktuellen
Informationen, E-Mail-Unterstützung durch Tutoren, Chat der Teilnehmer
mit einer Lehr- oder Betreuungsperson, Austausch zwischen den Teilnehmern usw. E-Learning. WBT ist damit flexibler als CBT mit Lernprogrammen, die über Datenträger bereit gestellt werden. Insbesondere
ist die schnelle Aktualisierung und Ergänzung möglich, da sie zentral
auf dem Server erfolgt und dann sofort allen Anwendern zur Verfügung steht.
Auch die Verknüpfung mit weiteren aktuellen Informationen anderer Anbieter
ist möglich. WBT ist - wie CBT - als alleiniges
Lernmedium problematisch und, wird deshalb eher in Kombination mit weiteren
Lernmöglichkeiten eingesetzt: Blended
Learning.
Weblog
/ Blog
ein "Web-Logbuch" mit einem breiten Einsatzgebiet, von einem persönlichen
Netztagebuch bis hin zu einer Community-Site mit aktuellen Beiträgen. Technisch
eine flexible Webseite, die auf einfache Art und Weise neue Beiträge aufnimmt
und es deshalb erlaubt, in loser Folge Einträge zu publizieren, auch Links,
Bilder, Video-Sequenzen oder Audiobeiträge. Oft können Leser die Beiträge
kommentieren, es entstehen Diskussionsstränge. Ein Medium mit derzeit (2005)
enormen Wachstumsraten und einer steigenden Bedeutung für die öffentliche
Meinungsbildung.
Blogs werden auch für politische Themen von gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren, zunehmend auch von Politikern/Politikerinnen genutzt. Es gibt zahlreiche Angebote im Internet, kostenlos ein Blog einzurichten, oder kostenlose Software, um es auf eigenem Server zu installieren. Ausführlicher siehe den Eintrag in Wikipedia.
Weisung (Anordnung, Befehl)
Verbindliche Aussage, was der Adressat tun oder nicht tun soll, woran er sich zu orientieren, welche Regeln er beachten soll; setzt entsprechende Befugnis und deshalb Über-/ Unterordnung voraus. Gegenüber einer nachgeordneten Behörde eine Weisung als Erlass oder Verfügung bezeichnet.
Werkstoffe
Energie, Schmierstoffe, Bleche, Papier und alle Güter, die im Produktionsprozess
eingesetzt und verbraucht werden (im Unterschied zu: »Betriebsmitteln:
sie werden gebraucht); ein »Produktionsfaktor.
Werte
sind "unsichtbare Führungskräfte" mit oft stärkerem Einfluss als formale und
transparente Anweisungen oder Vorschriften. Sie bestimmen, welche Denk- und
Verhaltensmuster innerhalb eines gesellschaftlichen Systems als wünschenswert
gelten. Da Unternehmen keine "geschlossenen Systeme" sind, sondern vom Austausch
mit ihrer Umwelt leben, müssen sie sich mit Wertveränderungen auseinandersetzen
und ihnen bei der Gestaltung der betrieblichen Lebenswelt Rechnung tragen. (Wunderer,
Führung und Zusammenarbeit, 2000, S. 173)
Wertschöpfung
Aktivitäten zur Erfüllung der Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden, bei
denen Materialien oder Informationen verändert oder verarbeitet werden, d. h.
ein Wert hinzugefügt wird. Nicht-wertschöpfende Tätigkeiten sind Kontrollen
oder wiederholte Tätigkeiten, die keine Veränderung des Arbeitsgegenstandes
bewirken.
Der Betrag der Wertschöpfung errechnet sich aus dem Wert, den das Unternehmen für seine Kunden schafft, abzüglich der Vorleistungen, die in den eigenen Prozess eingehen.
Wertschöpfungskette
Gliederung des gesamten Leistungsprozesses eines Unternehmens nach primären
bzw. unterstützenden Aktivitäten und bewertet hinsichtlich Wertschöpfungsbeitrag
bzw. strategischer Perspektive.
Wettbewerb
1. Situation, in der mehrere Anbieter eines Produktes
/ einer Leistung oder mehrere Nachfrager nach einem Produkt
vorhanden sind, so dass die jeweils andere Seite eine Wahlmöglichkeit hat. Das
ist i. d. R. die Situation auf einem Markt
... 2. Das Bemühen, Wetteifern der Konkurrenten ... wobei der Erfolg zu
Lasten der Mitbewerber geht. Mehr ...
Whistleblowing ("Alarm
schlagen" bei Missständen)
Weitergabe von Information über und Kritik an illegalem oder unethischen
Verhalten in einer Institution durch Insider, uneigennützig und trotz persönlicher
Risiken. Adressat der Informationen können zunächst die unmittelbaren
Vorgesetzten sein, aber auch die nächst höheren Stellen oder Aufsichtsgremien
unter Umgehung der Vorgesetzten und letztlich die Öffentlichkeit, wobei
vor allem letzteres besondere Aufmerksamkeit erfahren hat (Beispiele).
Die Akteure, "Whistleblower" oder "Hinweisgeber"
genannt, sind Mitarbeitende, die interne Informationen verwenden um auf ihrer
Meinung nach bestehende Missstände aufmerksam machen, damit u. U. geschriebene
oder ungeschriebene Regeln verletzen und persönliche Risiken in Kauf nehmen.
Sie handeln vorrangig uneigennützig. Mehr ...
WiBe
(früher: IT-WiBe / WiBe21 / WiBe 2007)
IT-gestütztes Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsberechnung in komplexen Entscheidungssituationen,
zunächst entstanden für IT-Maßnahmen, inzwischen aber zu einem generell
verwendbaren Instrument der Bewertung der Wirtschaftlichkeit
weiterentwickelt. Informationen
dazu auf der Website www.wibe.de
bzw. durch die KBSt.
Wirksamkeit: siehe Effektivität
Wirkung: siehe Outcome
Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
- WoV
Schweizer und österreichische Variante des Neuen
Steuerungsmodells, dort auch "New Public Management" genannt.
Besonderes Kennzeichen der Schweizer Konzeption ist die Neugestaltung des Verhältnisses
zwischen Politik und Verwaltung auf der Grundlage entsprechender Regelungen in
Verfassung und Gesetzen. Das Parlament steuert strategisch
durch Vorgabe von Wirkungszielen für
einen Zeitraum von mehreren (vier) Jahren und Bewilligung eines Globalbudgets
(siehe zur Reformkonzeption des Bundes "Führen
mit Leistungsauftrag und Globalbudget - FLAG", interne
Quelle im Online-Archiv).
Zur WoV gehört aber auch die Rechenschaftslegung über die Erreichung der Wirkungs-, Leistungs- und Finanzziele, in der Schweiz auf Bundesebene durch die Verpflichtung in Art. 170 der Bundesverfassung ... Mehr ...
Wirkungsrechnung (auch:
Wirksamkeitsrechnung)
Erweiterung des üblichen Rechnungswesens um Aussagen über die Wirkungen
der Leistungen (= Outcome) bzw. die Wirksamkeit
(Effektivität: Ausmaß der Erreichung
der politischen Ziele, den Beitrag zum Gemeinwohl durch die Leistungen), z. B.
über die Auswirkung von Vorsorgemaßnahmen auf die Gesundheit, von "Knöllchen"
auf Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Vgl. die Bedeutung dieses Begriffes
im Zusammenhang mit Verwaltungsmanagement und -reform: Effektivität
Wirtschaften
Entscheiden über den Einsatz knapper Ressourcen
um Ziele zu erreichen (einschließlich der Herstellung
von Gütern (Dienstleistungen) oder zur Erreichung
von Wirkungen/Outcome). Wenn eine solche Entscheidung
gut sein soll (rational / optimal),
erfordert das
Wirtschaftlichkeit Ausführliche
Darstellung | 15
Regeln der Wirtschaftlichkeit
Das nachhaltig günstigste
Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten.
In diesem Sinne ist eine Maßnahme, eine Entscheidung, eine Planung "wirtschaftlich", wenn sie im Vergleich mit allen anderen Alternativen das nachhaltig günstigste Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten erreicht.
Als Formel:
| Vereinfacht: |  |
| Genauer: | 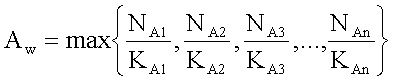 |
| Die wirtschaftlichste Alternative Aw ist die Alternative, bei der der Quotient aus Nutzen und Kosten den maximalen Wert hat. |
Beachte:
"Wirtschaftlichkeit" in diesem Sinne
Wer das Wort mit anderer Bedeutung verwendet, sollte dies klar zum Ausdruck bringen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Das Gebot wirtschaftlichen Handelns hat durch Art. 114 Absatz 2 Grundgesetz Verfassungsrang (zur Bedeutung s. Reinermann 2000, S. 5 ff[FN2]).
Verglichen werden in der öffentlichen Verwaltung Nutzen und Kosten der Alternativen. Soweit es dabei um Entscheidungen über die Erbringung von Leistungen (ob überhaupt bzw. Art und Weise der Leistungserbringung) geht und die Leistung einen Marktwert hat, kann, wie in der Privatwirtschaft, ein Vergleich von Ertrag und Aufwand erfolgen, der allerdings für die Beurteilung nicht ausreicht: die Auswirkungen auf die öffentlichen Anliegen, deretwegen die Verwaltung tätig wird (Outcome), sind in die Gesamtbewertung ebenso einzubeziehen wie sonstige (Neben-) Wirkungen. S. dazu das Prüfschema für Wirtschaftlichkeit.
"Wirtschaftlichkeit" ist zunächst kein Maß für die Rentabilität der Leistungserstellung, sondern für die Vorteilhaftigkeit einzelner Entscheidungen (siehe speziell zur Abgrenzung zur Privatwirtschaft).
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit sind die folgenden Entscheidungsregeln zur Erreichung maximaler Wirtschaftlichkeit. Es ist entweder
| Minimal- oder Sparsamkeitsprinzip |
|
|
Maximal- oder Ergiebigkeitsprinzip |
|
| Optimalprinzip (generelles Extremumprinzip / Simultanprinzip) |
|
Alle Bewertungen müssen nachhaltig zutreffen (s. die Erläuterungen in [FN1]).
Mehr ... sowie VV zu § 7 BHO und die Arbeitsanleitung für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des BMF / Typische Fehler bei Investitionen
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
systematisch durchgeführte und dokumentierte Untersuchungen zur Überprüfung
geplanter oder durchgeführter Maßnahmen auf Wirtschaftlichkeit unter
Verwendung anerkannter Verfahren (normativer
Begriff). Mehr ...
Wissen (engl. knowledge)
vom Menschen wahrgenommene und verwertbare Information(en).
Informationen werden erst als Wissen für den Menschen nutzbar, Wissen ist -
im Unterschied zu Informationen - an Menschen
gebunden. Allerdings können Informationen mit geeigneter Struktur maschinell
verarbeitet werden, was bereits Wertschöpfung bzw. ein Beitrag zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben sein kann. Wissen kann bewusst, sprachlich formuliert
oder formulierbar sein (explizites) oder nicht sein
(implizites Wissen). Siehe auch Wissens-Portfolio, Fähigkeitsstufen
Wissenschaft
methodisch betriebene Forschung und die Ergebnisse dieser Forschung. Forschung
beginnt mit der Sammlung, Ordnung und Beschreibung des Materials und setzt sich
fort in der Bildung von Hypothesen und Theorien sowie ihrer Überprüfung. Unabdingbar
ist, dass die Ergebnisse von anderen nachvollziehbar sind und die Ergebnisse
der Öffentlichkeit und damit der Überprüfung und Kritik zugänglich gemacht werden.
Zur empirischen Forschung gehört die Formulierung von Hypothesen, die an ihren Voraussagen in der Wirklichkeit überprüft und falsifiziert werden können. Dabei gelten die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität, Validität.
"Wissenschaft ist nicht der Besitz von Wissen, sondern das Suchen nach Wahrheit. Was wir Gesetze nennen, sind Hypothesen. Unser ganzes Wissen ist Vermutungswissen. Es muss kritisch überprüft werden." (Karl R. Popper). Ausführlich: Brodbeck, ABC der Wissenschaftstheorie für Betriebswirte. Beleg
Empirisch-wissenschaftlich fundierte Entscheidungen werden auch als "evidenzbasiert" bezeichnet. Eine solche Fundierung ist auch für Entscheidungen im Public Management von Staat und Verwaltung notwendig und ist - neben der Wirkungsorientierung - eine der Säulen einer "Neuen Verwaltungsführung" (New Public Management).
wissenschaftliches
Arbeiten
Arbeiten unter Beachtung der Anforderungen der Wissenschaft,
z. B. bei der Anfertigung von Facharbeiten, Hausarbeiten, Studienarbeiten,
Diplomarbeiten, Bachelor-Thesis, Magisterarbeiten, Doktorarbeiten: Website zu
wissenschaftlichem Arbeiten, generell bei empirischen Arbeiten (siehe Wissenschaft, Gütekriterien)
Wissensmanagement (engl.:
knowledge management)
als Aufgabe: Das tatsächlich vorhandene, an Menschen gebundene Wissen erschließen und zur
Verfügung stellen („Wenn die Firma nur wüsste, was die Firma weiß“). Mehr ..., Wissensportfolio
Workflow / Workflow-System
die IT-gestützte integrierte Vorgangsbearbeitung mit der Integration
von Datenbank, Dokumentenmanagement und Prozessorganisation in ein Gesamtkonzept.
Neben dieser heute verbreitete Bedeutung wird als Workflow z. T aber
auch - entsprechend der Bedeutung im Englischen - nur der Arbeitsablauf, Geschäftsprozess
als Gesamtheit der Tätigkeiten zur Erzeugung eines Produktes
bzw. zur Erstellung einer Dienstleistung verstanden. Workflow-System
ist - entsprechend der Hauptbedeutung des Wortes "Workflow" - das
IT-System zur Ablaufunterstützung, es umfasst insbesondere Dokumentenmanagement
und die elektronische Archivierung. Beispiel ist FAVORIT-OfficeFlow, das Flexible
Archivierungs- und VORgangsbearbeitungssystem im IT-gestützten
Geschäftsgang, das das Bundesverwaltungsamt
für die öffentliche Verwaltung bereitstellt.
WoV - siehe Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
Online-Verwaltungslexikon - © B. Krems - 1999-2026Online-Verwaltungslexikon - weiter
Zeichnung
Schriftliche Entscheidung durch Unterzeichnung einer Verfügung
(ggf. auch durch digitale Signatur). Wer zeichnet, übernimmt damit die Verantwortung
für die Entscheidung. Zeichnungsrecht, Mitzeichnung,
Geschäftsgang
Zeichnungsrecht, Zeichnungsbefugnis
Entscheidungsbefugnis; Befugnis zur verbindlichen Entscheidung für die betreffende
Institution; in der Verwaltung in der Regel nach dem Prinzip der Schriftlichkeit
durch Zeichnung (Unterzeichnung) einer Verfügung
(»Geschäftsgang). Mit dem Zeichnungsrecht
untrennbar verbunden ist die Verantwortung
für die getroffenen Entscheidungen (einschließlich der Nicht-Entscheidung
oder des Unterlassens). Im Bund geregelt in den §§ 15, 17, 18
GGO.
Zentralisierung (Zentralisation)
Zusammenfassung, Konzentration an einem Ort oder in einer Einheit/einer
Stelle; im spezifisch organisatorischen Sinne gleichbedeutend mit Spezialisierung,
d. h. Zusammenfassung bestimmter Teilaufgaben bei besonderen Stellen. Die
- nur - räumliche Zusammenfassung von Aktionseinheiten wird präziser "Konzentration"
und nicht "Zentralisierung" genannt.
Zentralisierungsarten »Spezialisierungsarten